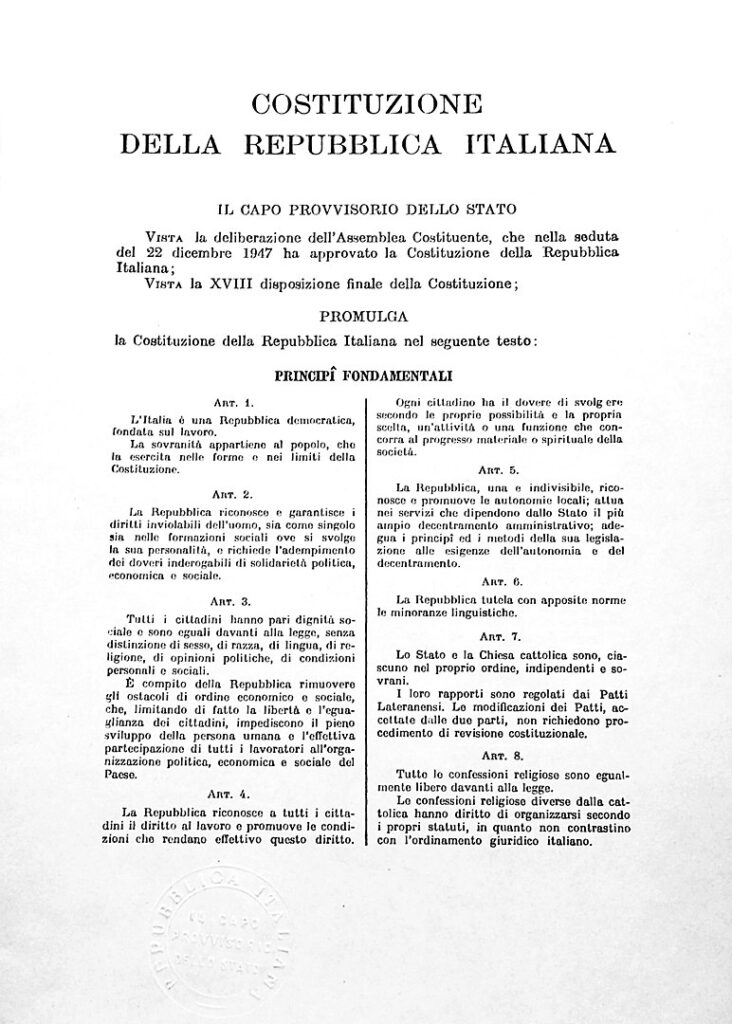Melonis Regierung ist stabil wie kaum eine vor ihr. Hat Italien jetzt also endlich die Regierung, die es wollte?
In Italien hat es in der Summe mehr rechte als linke Regierungen geben, weshalb es also nicht verwundern dürfte, das eine rechte Regierung deutlich fester im Sattel sitzt als manche linke oder gemischte vor ihr. Nur dass diese hier das Präfix „ultra-“ verdient hat und noch sicherer durch die Legislatur zu navigieren scheint als ihre rechten Vorgänger. Damit drängt sich erneut die Frage auf, die schon zur Wahl im September 2022 allerorten alarmierte: Ist Italien jetzt ein ultrarechtes Land geworden? Hat es einen tiefgreifenden politischen, ideologischen Wandel gegeben? Bleibt Italien jetzt rechts? Die ersten beiden Fragen würde ich klar verneinen, die dritte hat jedoch einiges Potenzial, mit Ja beantwortet werden zu können. Das wirkt paradox? Ist es aber nicht. Machtwille, Oppositionsschwäche und politische Resignation sind die Kombination, aus der Melonis Erfolg resultiert.
Faktor 1: Machtwille und Moderation
Der erste Grund für Melonis erfolgreiches Regieren ist an dieser Stelle schon mehrfach zur Sprache gekommen und soll daher nur kurz angerissen werden: Ihr gelingt es seit Amtsantritt, sowohl den faschistoiden Parteikollegen als auch den rechtspopulistischen Koalitionspartnern der Lega genau so viel Raum zu geben, dass sie den harten Kern der Wählerschaft bei der Stange halten und sich ausreichend profilieren können, damit sie nicht rebellieren. Denn zugleich gibt sich Meloni insbesondere auf internationaler Ebene moderat, gesprächsbereit, verlässlich. Keine radikalen wirtschafts- und finanzpolitischen Manöver und Bündnistreue im Falle des Ukraine-Krieges. Innerkoalitionär hält sie sich solange aus Polemiken und Streitereien raus, bis es nicht mehr geht, dann stellt sie sich zumeist vor ihre Kollegen und sagt intern: Basta. Machterhalt steht ganz vorn, deshalb geht Loyalität vor eigener Profilierung
Faktor 2: Die Opposition
Von dieser Eigenschaft könnten sich insbesondere die Kleinpartei-Anführer Carlo Calenda und Matteo Renzi etwas abschauen. Aber wenn es auf die ankäme, dann wäre die Situation schon eine ganz andere und Melonis Rechts-Koalition hätte ernsthafte Konkurrenz. Hat sie aber nicht. Und das liegt nicht an den profilierungssüchtigen Politikern der selbsterkorenen „Mitte“, sondern am Partito Democratico und dem Movimento 5 Stelle.
Für einen kurzen Moment nach der Regionalwahl in Sardinien im Februar sah es so aus, als könnte sich der Zusammenschluss von PD und M5S zum Kern des campo largo – dem Zusammenschluss aller Oppositionsparteien – tatsächlich zu einer Wahlalternative entwickeln. Dort gewann mit Alessandra Todde eine lokal und regional gut gelittene, pragmatische Kandidatin der Fünf-Sterne – allerdings im Endergebnis doch deutlich knapper als am Wahlabend vorausgesehen. Meloni hatte mit ihrem Kandidaten ein paar strategische Fehler begangen, aber die große Krise der Regierungskoalition, die manche da schon herbeireden wollten, folgte daraus nicht. Auch hier wirkte die Geschlossenheit nach außen, bei aller Kritik, die es intern gegeben haben wird. Vor allem aber konnte das Mitte-Links-Bündnis einen Monat später in den Abbruzzen den Erfolg nicht wiederholen und unterlag klar dem Kandidaten der Rechten. Parallel begannen die öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten um die Kandidatensuche zur Regionalwahl in der Basilicata und für den Oberbürgermeisterkandidaten in Bari. Dort, in Bari, zeigt sich nun die geringe Haltbarkeit des Bündnisses: Der Kommune droht Zwangsverwaltung wegen mafiöser Verstrickungen. Es wurden Anklagen gegen 130 Personen erlassen, während sich der Fall auf die Regionalregierung ausbreitet: Im Zentrum der politischen Diskussion steht nun der Kauf von Wählerstimmen, derentwegen die Beigeordnete der Region für Transport & Verkehr, Anita Maurodinoia, inzwischen zurückgetreten ist.
Für Giuseppe Conte, dem Vorsitzenden des M5S, tut es wenig zur Sache, dass seine Bewegung selbst Mitglied der Regionalregierung war, und die Angeklagten eigentlich aus dem Mitte-Rechts-Spektrum kommen und erst später zur linken Regierungsmehrheit übergewechselt sind. Wenn es um Stimmenkauf, um politische Korruption geht, dann ist der Kern der Fünf-Sterne-Bewegung getroffen. Nicht umsonst war ihr Slogan jahrelang onestà, Rechtschaffenheit. Eine Partei, die sich nicht klar von mafiösen Verstrickungen und gekauften Wählerstimmen distanzieren kann, ist kein Partner. Hier bedarf es klarer Kante, und so sind die Fünf-Sterne-Mitglieder der regionalen giunta mittlerweile von ihren Ämtern zurückgetreten – und fordern eine ähnlich klare Haltung unwirsch vom PD. Hier geht Profilierung definitiv vor Loyalität. In Bezug auf den Machtwillen fällt das Urteil weniger eindeutig aus: M5S hat viel zu verlieren, wenn sich die Bewegung nicht klar distanziert. Und gegebenenfalls etwas zu gewinnen, sollte der Makel der Korruption am PD haften bleiben. Nicht zu unrecht müssen sie sich daher den Vorwurf gefallen lassen, letztlich doch die Stimmen vom potenziellen Koalitionspartner klauen zu wollen anstatt vom Mitte-Rechts-Lager. Tatsächlich sind PD und M5S in inhaltlichen Fragen oft weit auseinander, etwa in der Haltung zur EU und zur Migration, doch die Gräben wirken auch deshalb so tief, weil sie anders als Melonis Regierungsbündnis die Sticheleien untereinander schlecht aushalten und vertiefen statt sie zu kitten. Angesichts eines solchen Skandals wie in Apulien halten die dünnen Bänder des Bündnisses dann umso weniger.
Für den Partito democratico ist es eine desaströse Lage: Auch im eigenen Wählerfeld gehören Korruption und politischer Betrug wohl zu den schlimmsten Vergehen (anders als in Teilen der rechten Wählerschaft, die schließlich jahrzehntelang problemlos Silvio Berlusconi wählte). Zudem mangelt es der Partei nach wie vor an inhaltlichem Profil, sie ist nach wie vor zwischen verschiedenen Strömungen hin und her gerissen. Da war es unabdingbar, sich wenigstens wieder als Alternative mit realistischer Machtoption präsentieren zu können – und das geht in der aktuellen Lage nur über den Movimento 5 Stelle. Verliert der PD nun kurz- bis mittelfristig diese Option, sehen selbst die eigenen Anhänger kaum noch eine Perspektive. Die Unterstützer des Mitte-Links-Lagers sind also nicht zwingend alle nach rechts gerutscht, sie sehen nur womöglich keine aussichtsreichen und/oder glaubwürdigen Kandidat:innen. Dieses Proble ist speziell für den PD nicht neu. Schon bei einigen vergangenen Wahlen häuften sich (Selbst-)Berichte, wonach „man wieder PD wählte“, einfach nur, weil man es immer getan hatte, nicht weil man überzeugt gewesen wäre oder sich etwas davon versprach. Somit verfallen die Wählerinnen und Wähler zunehmend in Agonie – und gehen gar nicht mehr zur Wahl.
Faktor 3: Abstinenz
Was kostet eine Wählerstimme? Die oben genannten Skandale lassen den Blick nicht nur auf die Politiker:innen richten, die sich mit Geld einen Sitz im Kommunal- oder Regionalrat sicherten (nicht nur in Apulien, auch im Piemont und auf Sizilien laufen Ermittlungen). Was ist den Wählerinnen ihre Stimme wert? 50 Euro, wie es scheint. Oder eine bezahlte Rechnung. Heizung, Strom, ist schließlich alles teurer geworden. Klassisch natürlich auch der angebotene Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Wie Goffredo Buccini im Corriere della Sera vom 8. April zurecht feststellt, sagt der Tauschwert einer Wählerstimme viel über den Stellenwert der Demokratie aus. Beziehungsweise über den empfundenen Wert des eigenen Votums: Wenn ich breitwillig die inzwischen berühmt gewordene bombola di gas, die Gasflasche fürs Haus, gegen mein höchstes demokratisches Recht, frei zu wählen, eintausche, dann muss ich überzeugt sein, dass mir die Gasflasche mehr bringt als die Wahl.
Das ist eine traurige Feststellung. Und doch eine, die ins Bild passt. Denn immerhin bekommt die Person eine Gasflasche, oder eine bezahlte Rechnung. All diejenigen, die weder in Sardinien noch in den Abruzzen ihre Stimme gar nicht erst abgegeben haben, erhalten gar nichts. Ist damit nicht schlau, wer sich wenigstens fünzig Euro in die Hand drücken lässt? 47,81 Prozent erhielt die „Partei der Nichtwählenden“ in den Abbruzzen, 47,7 Prozent in Sardinien. Zur nationalen Parlamentswahl im September 2022 waren es zwar nur 36,09 Prozent, aber immerhin hielt es mehr als ein Drittel für verzichtbar, seine Stimme abzugeben. Jedes Mal wird dies erschrocken vermerkt – und dann konzentriert man sich auf die Reaktionen und Streitereien der Parteien, obwohl diese im Vergleich viel weniger Zuspruch erhielten: Die stärkste Kraft Fratelli d’Italia erhielt in den Abruzzen gerade mal 24,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Es werden alle Politiker:innen angehört, was sie zum Wahlergebnis sagen, dabei wäre es interessant zu hören, was die Einwohnerinnen der Kommunen zu sagen haben, in denen fast 80 Prozent der Wahlberechtigten zuhause blieben.
Wahrscheinlich sagen sie: Es macht keinen Unterschied. Ich versuche, über die Runden zu kommen, meine Sorgen sind die Rechnungen, die Arbeit, die Kinder oder auch die fehlende Arbeit der Kinder, liegt die Jugendlichenarbeitslosigkeit in der Region doch laut Eurostat bei mehr als 19,5 (2021). Die Auffassung, dass sich ohnehin nichts ändert, mag nicht gerechtfertigt sein. Gleichwohl nähren Politiker:innen verschiedener Parteien immer wieder das Narrativ, dass es den anderen Parteien nur um Ämter und Zugriff auf Pfründe ginge. Solche Nachrichten wie die aus Apulien verstärken dieses Bild, ebenso die kontinuierlichen Streitereien und Vorwürfe untereinander. Vom PNRR, dem milliardenschweren Wiederaufbauprogramm der EU, von dem Italien besonders stark profitiert, ist seit längerem nur in Randnotizen zu hören. Zur Erinnerung: Die Konzeption dieses Plans brachte immerhin die Regierung Conte II zu Fall. Gibt es ein Programm, eine Vision? Wohin soll sich das Land entwickeln? So richtig mag man das weder für das rechte noch für das linke
Wahrscheinlich sagen sie: Es macht keinen Unterschied. Ich versuche, über die Runden zu kommen, meine Sorgen sind die Rechnungen, die Arbeit, die Kinder oder auch die fehlende Arbeit der Kinder, liegt die Jugendlichenarbeitslosigkeit in der Region doch laut Eurostat bei mehr als 19,5 (2021). Die Auffassung, dass sich ohnehin nichts ändert, mag nicht gerechtfertigt sein. Gleichwohl nähren Politiker:innen verschiedener Parteien immer wieder das Narrativ, dass es den anderen Parteien nur um Ämter und Zugriff auf Pfründe ginge. Solche Nachrichten wie die aus Apulien verstärken dieses Bild, ebenso die kontinuierlichen Streitereien und Vorwürfe untereinander. Vom PNRR, dem milliardenschweren Wiederaufbauprogramm der EU, von dem Italien besonders stark profitiert, ist seit längerem nur in Randnotizen zu hören. Zur Erinnerung: Die Konzeption dieses Plans brachte immerhin die Regierung Conte II zu Fall. Gibt es ein Programm, eine Vision? Wohin soll sich das Land entwickeln? So richtig kann man das weder für das rechte noch für das linke Lager sagen. Es gab viele sehr unterschiedliche Regierungen in den letzten Jahren, was sie bewirkt haben ist für die Bürger:innen wahrscheinlich nicht einmal so klar festzustellen. Nun also eine ultrarechte Regierung, mal sehen, so schlecht läuft es ja nicht.
Natürlich sind auch unter den Nichtwählenden welche, die auf die EU wettern, die Sympathien für Putin hegen und die etwas gegen Migrant:innen haben. Wahrscheinlich aber überwiegt der herablassende Rassismus deutlich den hasserfüllten Rassismus. Den Filippino im Haushalt und den Araber auf der Baustelle sieht man nicht als gleichwertig an: doch lieber die machen diese Arbeit als man selbst, vor allem, wenn man auf den Baustellen doch nur stirbt, wie unlängst in Florenz. Was nicht heißt, dass man sie aus dem Land haben möchte, nur, wenn es so weit kommen sollte… einige würden sich finden, die dagegen protestieren, die Solidarität zeigen, andere nicht. Resignation, was die Repräsentation der eigenen Interessen angeht, resultiert in Gleichgültigkeit, wenn es an grundlegende Werte des politischen Systems geht: Grundrechtssicherung, Medienfreiheit, Rechtsstaatlichkeit.
Wenn die wichtigsten Posten der RAI mit Getreuen der Regierung besetzt werden, diskutieren das die Medien. Vielleicht wird es für die Gesellschaft relevant, wenn die Sanremo-Ikone Amadeus nun der RAI seinen Rücken kehrt. Er war nun wirklich mehrheitsfähig, mit Rekordeinschaltquoten jedes Jahr aufs Neue, mit eine keineswegs rechtskonservativen Programm. Aber vielleicht schalten sie nur einfach um, wechseln mit ihm den Sender. Diese Resignation aber ist es, die es der aktuellen Regierung ermöglicht, punktuell ihre ideologisch-kulturellen Marker zu setzen. Die Dominanz der Medien ist ein Aspekt, Fragen der Abtreibung, der Rechte gleichgeschlechtlicher Paare etwa ein anderer. Auf diese Weise können sie das Land in eine erzkonservative Richtung wandeln, mit kleinen Maßnahmen im rechtlichen Rahmen, aber auch im Diskurs. Den Diskurs kann die Opposition zwar weiter mitgestalten – wenn sie aber keine wirkliche Gestaltungsoption hat, wird dies aber schwierig bleiben.
So kann Italien (ultra-)rechts werden und bleiben, ohne dass es dazu eine aktive Bewegung gegeben hätte. Nur eine kluge Anführerin, die die Situation für sich zu nutzen weiß.