Giorgia Meloni gibt ein wenig überraschend den Startschuss für eine Reformierung des Regierungssystems. Neu ist das Vorhaben nicht.
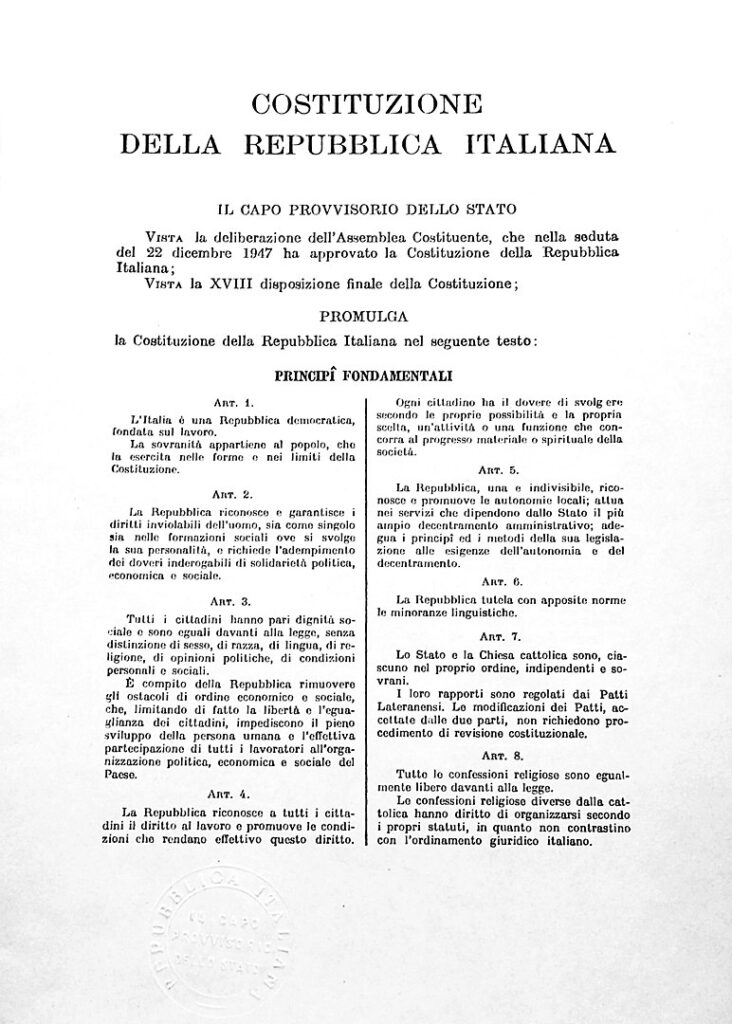
Giorgia Meloni hatte sie seit Jahren gefordert und im Wahlkampf angekündigt, und dennoch schien es so vieles zu geben, was wichtiger war als eine Verfassungsreform. Nun, nach etwas mehr als einem halben Jahr im Amt, will ihre Regierungsmehrheit ernst machen. Erste Gespräche mit der Opposition sind anberaumt, vorsichtige Gesprächsbereitschaft wird signalisiert. Eine Verfassungsreform. Mal wieder. 2016 ist die letzte gescheitert, und mit ihr krachend die vielversprechende Karriere des Matteo Renzi. Oder war es umgekehrt? Der Karriere von Silvio Berlusconi konnte seine gescheiterte Verfassungsreform von 2006 wenig anhaben, dem Ansehen der Verfassung hat sie allerdings umso mehr geschadet. Jetzt also ein neuer Anlauf und es ist noch offen, ob dieser eher der Regierung schaden wird oder der konstitutionellen Demokratie Italiens.
In der aktuellen Debatte fallen zwei Dinge auf: Erstens sind es dieselben Argumente wie vor 15, 20 Jahren, sowohl in den Zielen wie in den Begründungen. Zweitens haben diese Jahrzehnte der Schrauberei an den Grundlagen der politischen Ordnung dazu geführt, dass so einige fundamentale Prämissen verrutscht sind. Zu ersterem: Stabilere Regierungen und eine direkte Verbindung zwischen Wahlvolk und Regierung, darin besteht Melonis erklärtes Ziel der Reform. Entweder ein (Semi-)Präsidialsystemine oder eine Direktwahl des Premiers, einhergehend mit der Stärkung ihrer Kompetenzen. Parlamentarische Demokratie aus dieser Sicht? Verlangsamt lediglich die Prozesse und bietet zu viel Raum für Mauscheleien und Abtrünnige (= Sturz bestehender und Installation neuer, im schlimmsten Fall: technokratischer Regierungen). Damit will die Regierung Meloni endlich Schluss machen, so wie zahlreiche Regierungen vor ihr. Dass sich die Fraktionen der Regierungsparteien – oder ihrer Vorgängerversionen – an genau solchen Mauscheleien, Fraktionswechseln, Regierungsstürzen genauso beteiligten wie an der Einsetzung technokratischer Regierungen – geschenkt. Dass es andere Wege gäbe, die Regierungschefin zu stärken als ihre Direktwahl einzurichten, wird immerhin als mögliche Kompromissvariante akzeptiert, aber nicht tatsächlich verfolgt.
Zu zweiterem: Meloni sagt, sie möchte eine möglichst breite Verständigung über die geplante Reform, aber so oder so habe sie das Mandat für eine solche Reform von den Italiener:innen erhalten. Hat sie das? Sie hat das Regierungsmandat erhalten, aber dezidiert eines, die grundlegenden Pfeiler des demokratischen Systems zu ändern? Bis zum „Sündenfall“ 2001/2002, als die damalige Mitte-Links-Regierung einzelne Verfassungsänderungen zur Kompetenzverteilung zwischen Regionen und Zentralstaat mit lediglich absoluter Mehrheit verabschiedete, galt in Italien eindeutig: Für eine Verfassungsreform wird eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Dies war viele Jahrzehnte dem Umstand geschuldet, dass die vorgesehene „Notbremse“ für einen solchen Fall, das Verfassungsreferendum, nicht in Kraft gesetzt worden und damit nicht verfügbar war. Doch auch nach dessen Einrichtung hielt sich zumindest der Grundgedanke, dass eine signifikante Änderung der demokratischen Spielregeln das Einverständnis einer breiten Mehrheit bedürfe.
Davon ist nur noch in Ansätzen etwas zu spüren. Nachdem 2005/2006 die damalige Berlusconi-Regierung mit Verweis auf die linke Vorgängerregierung eine umfassende Reform des politischen Systems nur mit den Stimmen der Regierungsmehrheit durchs Parlament brachte, brach etwas weg im Verfassungsverständnis der politischen Elite. Eine Verfassungsreform war ein mögliches cavallo di battaglia, ein Profilierungsprojekt für das politische Lager. Auch Matteo Renzi zehn Jahre später, wählte nur anfangs den Ansatz einer lagerübergreifenden Reform. Als Allianzen zerbrachen und Widerstände aufkamen, zog er allein durch – und verlor. Dass beide Reformversuche an der Wählerschaft scheiterten, für die sie doch angeblich gemacht worden waren, wirkte kurzzeitig beruhigend auf die Lage. Benötigen wir wirklich solche tiefgreifenden Reformen? Und wenn ja, sollten sie dann nicht doch eher über eine Sonderkommission der Parlamentskammern ausgearbeitet werden, einer commissione bicamerale wie in den 1990er Jahren? Denn auch das war einmal common sense: Verfassungsreformen sind parlamentarische Initiativen, nicht Teil des (dezidiert politischen) Regierungsprogramms. Also bringt sie auch nicht die Regierung ein. Acqua passata.
Heute hat eine Meloni „das Mandat des Volkes“ für eine Verfassungsreform, heute fabuliert Matteo Salvini davon, dass – wenn die Opposition nicht will – eben das Volk sein Votum für die Reform geben wird. Ein bestätigendes Referendum existiert in Italien aber gar nicht. Es wurde darüber in den vergangenen Jahrzehnten schon öfter gestritten, denn nicht erst die Rechtspopulisten beschwören die direkte Verbindung zwischen Volk und Regierung(schef). Das öffentlich postulierte Demokratieverständnis dreht sich schon seit langem weg von der parlamentarischen Repräsentation hin zum vermeintlich unmittelbaren Ausdruck des Volkswillens durch die vermeintlich direkt bestellte Regierung. Und insbesondere deren Oberhaupt. Deshalb auch der dringende Wunsch nach einem direkt gewählten Staatschef oder eine direkt gewählten Premierministerin.
Die Frage, die sich dabei zum wiederholten Male stellt, lautet: Hilft eine solche Reform denn wirklich mehr als sie schadet? Erwächst Stabilität tatsächlich aus einer Direktwahl? Ist ein politisches System nicht nur immer so stark und stabil, wie es seine politischen Führungskräfte erlauben? Selbstverständlich hat ein französischer Präsident mehr Macht als ein italienischer Premier. In den letzten Jahren kann man beobachten, wie dies auch in Frankreich die Spaltung der Gesellschaft fördert und Umwälzungen im Parteiensystem nicht ausschließt. Das Vereinte Königreich, dieses andere glorreiche Beispiel vergangener Jahre für die Macht einer Regierungschefin, zeigt, dass der Verfall politischer Tugenden und Fähigkeit auch vor den traditionsreichsten Demokratien nicht Halt macht. Effektive Macht hängt an Autorität und Überzeugungskraft gegenüber den Beherrschten, an Disziplin und Loyalität der Parteien und Fraktionen gegenüber ihrer Führung.
Beides gab es in Italien über einen zu langen Zeitraum nicht. Mit der Ausnahme der Staatspräsidenten, die bei aller Kritik über die mögliche Ausdehnung ihrer Kompetenzen in den vergangenen Jahren immer wieder die fragile Stabilität des politischen Systems garantierten. Hinterzimmerpolitik, beschimpfen es die einen. Selbstschutz des Staates vor einer allzu oft unfähigen politischen Führung, könnte man es auch nennen. Und just dann, wenn die Staatspräsidenten wieder zu großer Form aufliefen, wirkte der Gedanke an ein Präsidialsystem besonders charmant. Zuletzt diskutierten Medien und Politik diese Frage, als im Raum stand, dass Mario Draghi ins Amt des Staatsoberhauptes wechseln könne. Für einen wie Draghi wäre ein solches Amt doch wie gemacht, welches Wohl überkame die italienische Nation mit einem mächtigen Presidente della Repubblica wie ihm?! Nur sind nun nicht viele der politischen Exponenten aus einem solchen Holz geschnitzt. Nicht viele haben ein solch tiefes Institutionenverständnis wie Amtsinhaber Sergio Mattarella, frei von egozentrischen Eskapaden. Eine Direktwahl des Staatsoberhauptes würde andere Kandidat:innen hervorbringen als die indirekte, durch hohe Mehrheiten regulierte Wahl mittels parlamentarischer Vollversammlung. Es wäre ein politischer Wettbewerb und die Parteichefs würden antreten: Salvini, Meloni, Schlein, Calenda. Oder früher: Renzi, Berlusconi. Vorstellbar? Natürlich. Wünschenswert? Da sind Zweifel angebracht. Die Wankelmütigkeit, die fehlende Qualität, der Egozentrismus würde kaum weichen, die Intrigen zwischen Parteien und innerhalb der Fraktionen ebensowenig. Was fehlen würde, wäre der externe Ausgleich, die hintergründige Steuerung und Beratung durch den Staatspräsidenten. Ein Sturz oder eine Abwahl des neuen Regierungsoberhaupts wäre schwieriger – dies könnte zu Anpassungen führen, in der Auswahl der Kandidat:innen, in der politischen Taktik, vielleicht zu mehr Ruhe in Gesetzgebungsvorhaben. So, wie es das positive Beispiel der Bürgermeister:innen und Regionalpräsidenten auf lokaler und regionaler Ebene vormachen. Das erhoffen sich die Befürworter:innen, die es ernst meinen mit dem Wohl der italienischen Demokratie. Allerdings: Italien ist kein ausgeprägter Förderalstaat, die Befugnisse von Regionalpräsident:innen sind nicht allzu groß. Einen heterogenen Staat wie Italien zu führen, ist noch einmal eine andere Liga. Insofern hat die Sorge der Gegner eines Präsidialsystems etwas für sich: eine stärkere Spaltung der Gesellschaft, eine weitere Stärkung der Mehrheitslogik ohne Rücksicht auf Minderheitenmeinungen (und womöglich sogar -rechte, blickt man auf die heutige Regierung). Die Unruhe würde sich verlagern, aber nicht verschwinden. Es wäre eine starke Regierung des einen Teils der Gesellschaft gegen die andere. Wohin das führen kann, sieht man an der dritten, „alten“ Demokratie dieser Welt, den USA.
